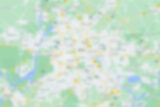von Leander von Criegern
In der oft durch das europäische Festland überschatteten Musikwelt Großbritanniens war Hubert Parry (1848–1918) im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eine der bedeutendsten Figuren. Seinen Einfluss hatte er dabei sowohl als Musikwissenschaftler mit 123 Einzelbeiträgen für Grove’s Dictionary of Music and Musicians – welches in aktualisierter Form noch heute das wichtigste englischsprachige Musiklexikon ist – und als Komponist geltend gemacht. Hierbei bediente er sich insbesondere in seinen fünf Sinfonien der deutschsprachigen Kompositionstradition, zu der er eine große Affinität hegte. Der erste Weltkrieg löste bei Parry im Gegensatz zu Zeitgenoss*innen keine Kriegsbegeisterung oder Nationalismus, sondern aufgrund seines Pazifismus große Bestürzung aus. Schneller als bei seinen Zeitgenossen spiegelte sich der Horror des Krieges in seiner Musik wieder. My Soul, There Is a Country (1913–1915) aus den Songs of Farewell drückt eine solche Sehnsucht nach Frieden aus, nicht nur auf einer politischen, genauso auch auf einer persönlichen Ebene, denn in der Zeit der Komposition litt der Komponist bereits unter erheblichen gesundheitlichen Problemen. So ist es vielleicht auch etwas weniger verwunderlich, dass er trotz seiner agnostischen Einstellung angesichts der Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit und der globalen Zerstörung auf einen zutiefst religiösen Text von 1650 zurückgriff. Darin werden eigener Sehnsuchtsausdruck und Friedensutopie nebeneinandergestellt, die in Parrys Lied durch Tonart- und Taktartwechsel musikalisch deutlich voneinander getrennt sind.
Haydns Schöpfung, mittlerweile integral im chormusikalischen Kanon etabliert, gehört zu den meistaufgeführten und -aufgenommenen Werken der Gattung des Oratoriums. Dabei verlief seine Rezeption keineswegs so geradlinig erfolgreich, wie es sich aus einer heutigen Perspektive heraus vermuten lassen könnte. Die ersten Aufführungen der Schöpfung ab 1798 lösten eine erste Welle des Enthusiasmus beim europäischen Konzertpublikum aus. Besonders in England war die Begeisterung groß, wo das Stück sich in Bezug auf die Popularität nur mit Händels Messias messen musste: Immerhin gingen über die Hälfte der etwa 500 Exemplare der Erstveröffentlichung der Partitur dorthin. Reihenweise wurden Gesangsvereine gegründet, nur um die Schöpfung einzustudieren. Georg August von Griesinger konstatierte schon 1801: «In aller Welt ertönt das Werk». Dass diese «Welt» äußerst exklusiv und sich dazu auf Europa beschränkte, sei hier außen vorgelassen, die Rezeption durch das Publikum gestaltete sich jedenfalls zunächst durchweg positiv. Dagegen entbrannte unter Musikkritikern schnell eine heftige Kontroverse bezüglich Haydns Verwendung von Tonmalerei, also musikalische Nachbildungen von Szenen aus dem Text, aus. Der konsequente Gebrauch dieses Stilmittels brachte Vorwürfe der «mechanischen Gehorsamkeit» gegenüber dem Text mit sich. Vor allem dürfte es im zeitgenössischen Publikum Assoziationen mit den zu der Zeit in Europa bekannten, wandernden savoyardischen Schaustellern hervorgerufen haben. Diese Unterhalter erzählten typischerweise Geschichten mithilfe von Drehorgeln und «Magischen Laternen» – Laternenartige Geräte, die auf einer Glasplatte gemalte und dargestellte Szenen auf eine Leinwand projizierten. Diese Praxis brachte mitunter Konnotationen von volkstümlicher «Banalität» und einfachem Effekt mit sich, welche sich auch auf das Werk übertrugen. Dahingehende Kritik am Werk bestand noch für etwa die nächsten 50 Jahre, bis zu einem Zeitpunkt als das Konzept der Programmmusik allgemein war. Für diese war die Tonmalerei ein wichtiges kompositorisches Mittel, Haydns Stück wurde dabei mittlerweile sogar als Beispiel zurückhaltender Verwendung derselben angesehen.
Judith Weirs Ablehnung avantgardistischer Tonsprache lässt sich sehr deutlich in ihrem Stück Love Bade me Welcome von 1997 erkennen. Es wäre schwierig, vergleichbare Werke bei ihren Zeitgenoss*innen zu finden. Die Komponistin zieht ihre Inspiration vielmehr aus folkloristischen Materialien, besonders derer Schottlands, wo sie lange Zeit studiert und gewirkt hat. Aber auch darüber hinaus haben Geschichte und andere außermusikalische Elemente einen großen Einfluss auf ihre Kompositionen. So bekennt sie sich unter anderem dazu, die Arbeit Ai Weiweis zu bewundern und sich an ihm Beispiel zu nehmen. Für Love Bade me Welcome bediente Weir sich des Gedichts Love (III) des Englisch Poeten George Herbert aus dem Jahr 1633, den letzten Teil seines größeren Zyklus The Temple. Im Gedicht wird der Protagonist von «Love» – hier der christliche Gott – als Gast zum gemeinsamen Essen eingeladen. Ein Gedicht, das für die Entstehungszeit außergewöhnlich ist, da der Protagonist, ein ansonsten normaler Mensch, auf eine Ebene mit «Love» gestellt, also als ebenbürtig beschrieben wird.
George Walker (1922–2018) musste als Afroamerikaner nicht nur mit in Gesetzen verankertem Rassismus leben, sondern obendrauf in der Szene der Klassischen Musik viele Wege als Erster gehen und Meilensteine als erster erreichen. Daraus hervor gingen Tätigkeiten als Konzertpianist und als Dozent und Professor an verschieden amerikanischen Institutionen. Allen voran steht aber ein beeindruckendes Œuvre an Kompositionen, das vor allem in seiner stilistischen Vielfalt besticht. Darin machte er gerne etwas, das Schönberg für unmöglich hielt, indem er klassische Formmodelle mit einer modernen, dissonanten Tonsprache verband. Die Three Lyrics for Chorus (veröffentlicht 1971) stellen dabei noch eine relativ frühe, weniger dissonante Variante dessen dar. Später würde Walker diesen Weg in seinen teilweise seriellen, teilweise frei atonalen Klaviersonaten oder in seiner Mass zu seiner logischen Konsequenz weitergehen.
A Flowering Tree von John Adams entstand 2006 anlässlich des 250. Geburtstags von Mozart und wurde daher als eine Art Hommage an dessen Zauberflöte konzipiert. Die Oper erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus einer armen Familie, Kumudha, die sich in einen blühenden Baum verwandeln kann und so die Aufmerksamkeit des Prinzen erlangt. Nachdem die beiden anschließend heiraten, erfahren sie aber durch unglückliche Geschehnisse einen plötzlichen sozialen Absturz und werden voneinander getrennt, bevor sie am Ende wieder zueinander finden. Die Textgrundlage hierfür waren die Edition und Übersetzung von südindischer – genauer kanaresischen – mündlich überlieferten Volkssagen durch den indischen Poeten A. K. Ramanujan. Der im Konzert aufgeführte «¡Lindas Flores!»-Chor («Schöne Blumen!») stammt aus dem ersten Akt der Oper. In der Szene gehen Kumudha und ihre Schwestern auf den Markt und verkaufen die Blüten, die sie vorher von ihrer Baumform gepflückt haben, um ihrer materiellen Notlage zu entkommen. Der Chor übernimmt hierbei sowohl die Stimmen der Schwestern als auch die der Marktbesucher, die ineinander fließen und zusammen mit dem instabilen Rhythmus der ständig wechselnden Taktarten (meist 2/2- und 3/4-Takt) auf die stereotypisch hektische Atmosphäre von Märkten anspielen.
Er war «the greatest man who ever drew a bow», meinte der selber mehr als fähige Violinist Fritz Kreisler über Pau Casals (1876–1973), den damals weltberühmten spanisch-puertoricanischen Cellisten. Besonders mit seiner Aufnahme der sechs Cellosuiten von Bach hinterließ er ein immer noch relevantes Vermächtnis, für das er auch schon zu Lebzeiten neben vielen weiteren Auszeichnungen die Freiheitsmedallie der USA erhielt. Als überzeugter Republikaner musste Casals 1936 aufgrund des Sieges der Faschisten im Spanischen Bürgerkrieg sein Heimatland verlassen. Sein Hass Franco gegenüber war so groß, dass er über sein gesamtes restliches Leben hinweg Auftritte in Ländern, die das Regime anerkannten, verweigerte. Eine einzige Ausnahme machte er hierbei für ein Konzert im Weißen Haus für John F. Kennedy, den er persönlich verehrte. Casals war auch als Komponist tätig, wobei heutzutage meist nur noch seine Komposition O vos omnes (vermutlich 1932) aufgeführt wird. Das Werk verwendet einen vulgärlateinischen liturgischen Text, der vor allem im 16. Jahrhundert gesungen wurde, und dessen berühmteste Vertonung, vor Casals’ eigener, von Carlo Gesualdo, einem bedeutenden Komponisten der Spätrenaissance, stammt. Die Tonsprache in Casals’ Stück ist, möglicherweise auch inspiriert durch Gesualdos Vorbild, geprägt durch eine eher konventionelle Harmonik. Sie war dabei aber auch nicht ungewöhnlich «konservativ» für ihre Zeit, auch wenn man die 1930er-Jahre gerne nur mit Zwölftonmusik in Verbindung bringt.
Mendelssohns Elias wurde erst 1846, ein Jahr vor seinem Tod, von ihm fertiggestellt. Das Oratorium hat in der gegenwärtigen Chormusik einen ähnlichen hohen Stellenwert wie Haydns Schöpfung, die Entwicklung dahin war aber eine grundsätzlich andere. Das Mendelssohn-Werk zog abgesehen von Richard Wagners antisemitischer Hetze kaum kritische Stimmen auf sich. Es mussten aber immerhin einige wenige Jahre vergehen, bis seine Popularität die des Paulus, ebenfalls ein Mendelssohn-Oratorium, überragte und schließlich als beliebtestes Oratorium im 19. Jahrhundert galt. Einen Bruch in seiner Rezeptionsgeschichte erlebte Elias dann in den 1920er-Jahren. Schon bevor die Aufführung von Mendelssohn-Werken durch die Nazis nach 1933 quasi verboten wurde, wurden dieses und andere Stücke schon gegen Ende der 20er-Jahre kaum noch in Deutschland aufgeführt. Die Folge war ihr gänzliches Verschwinden aus der deutschsprachigen Kulturlandschaft, auch weit über die unmittelbare Nachkriegszeit hinaus: Mendelssohn war in Öffentlichkeit, Kunst und Wissenschaft unbekannt oder irrelevant. Lange Zeit waren nur englischsprachige Aufnahmen des Werkes existent und erst in den 70er-Jahren kehrte Elias schließlich auch hierzulande wieder regelmäßig auf die Spielpläne zurück.